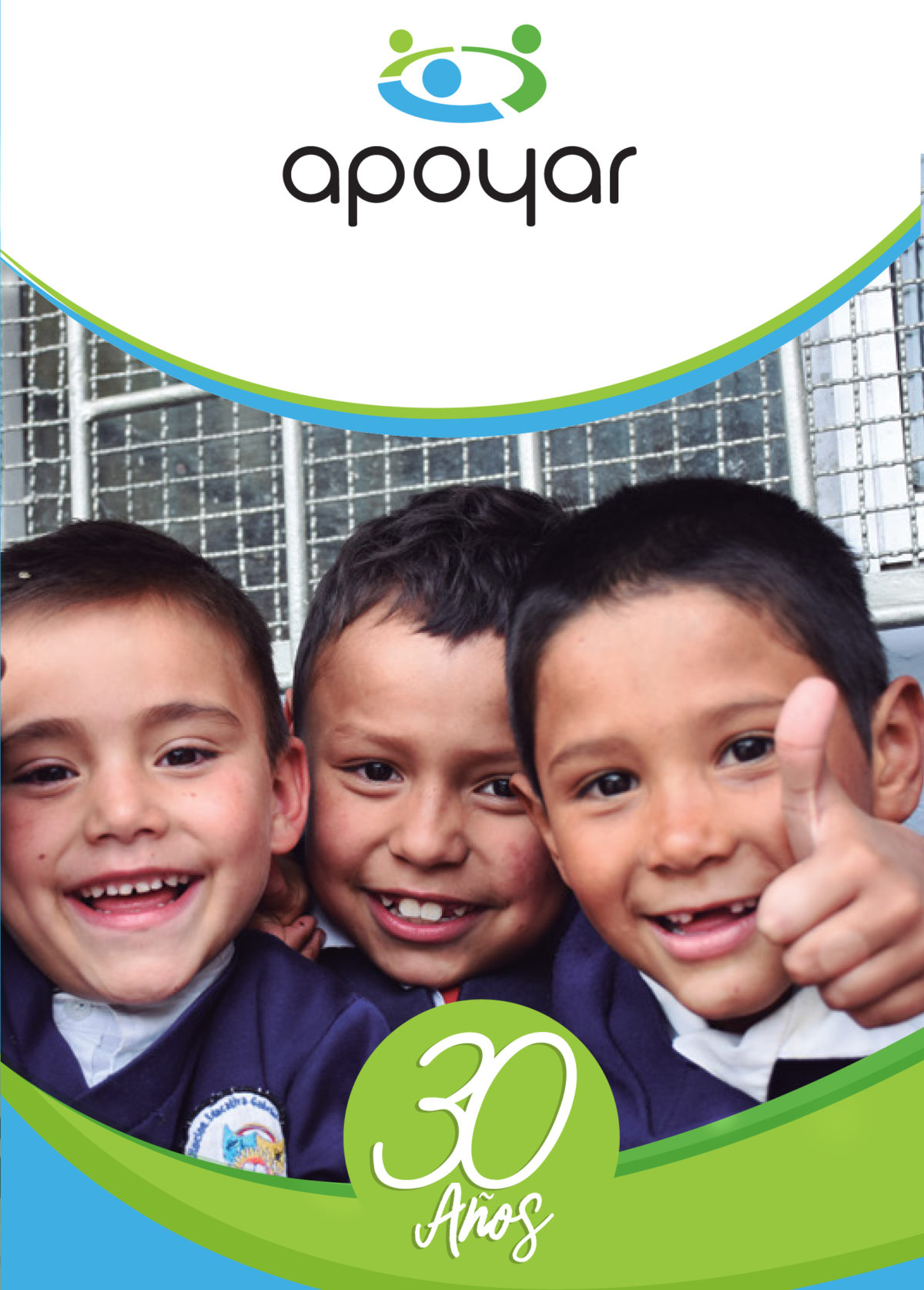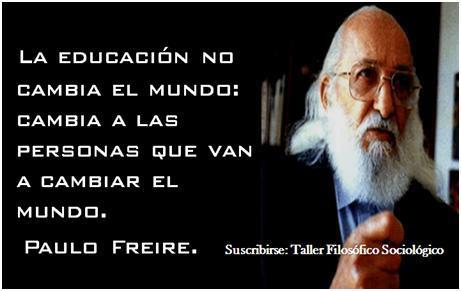Leider hat es in der Schweiz zu meiner Zeit keine Landjugendheime gegeben sonst hätten wir jungen Leute aus den Landgebieten einfacher Zugang zur Mittelschule gehabt. Damit ich meine Handelsmatura im Kollegium Brig (VS) machen konnte musste ich im Internat leben und das war für damalige Verhältnisse nicht billig. So hatte ich keine andere Wahl als im Freiluftrestaurant Baschi in Geschinen (Goms) während den Ferien die im Wallis so beliebten Raclette zu “streichen” und damit den Aufenthalt in Brig zu finanzieren.

Daran dachte ich immer wieder, als ich anfangs der 70-ger Jahre die in Kolumbien bekannten Landjugendheime kennenlernte. Ihr Gründer und Direktor Pater Ivan Cadavid war damals ein guter Freund von mir.

Er kannte die enorme Problematik der Landjugend, die nur mit Mühe die Primarschule abschliessen konnte. Ein Weiterstudium an einer Mittelschule war ausgeschlossen, weil sich diese viel zu weit vom Elternhaus befand und der einfache Landbauer zu wenig Geld besass, um ein Internat zu bezahlen.
So kam mein Freund Cadavid auf die ausgezeichnete Idee, sogg. Landjugendheime aufzubauen. Hier handelt es sich immer um ein Heim für rund 50 – 100 Jugendliche in der Nähe eines grösseren Dorfes, welches mit einer guten Mittelschule rechnet. Hier kann der,die junge Student-in während der Woche leben, im Dorf studieren und am Wochenende zu seinen-ihren Eltern aufs Land. Jedes Heim hat ein grösseres Landstück, damit die wichtigsten Esswaren selber angebaut werden können.

Als ich 1977 meine jetzige Frau Ana Dilia und ihre Provinz – Caldas – kennenlernte, fand ich sofort die gleiche Problematik vor: viele junge Menschen aus dem Land konnten keine Mittelschule besuchen; diese war zu entfernt und das wenige elterliche Geld reichte nicht für die Ausgaben während der Woche.

Somit begann der Aufbau des ersten Landjugendheimes in Arboleda: 5 Hektaren Land und ein einfaches aber gut eingerichtetes Heim, wo die Landjugendlichen während der Woche wohnten. Der Erfolg war gross und ich entschied mich zu einem weiteren Heim: Florencia (Geburtsort meiner Frau). Dort kauften wir rund 14 Hektaren Land und begannen mit dem Aufbau. Noch bevor der erste Ziegel gelegt wurde stellte man mich vor 2 Alternativen zum Aufbau der Gebäude: Vertrag mit einem Baumeister, der die Arbeit in 4 Monaten abschliessen würde oder die Rekrutierung von 30 jungen Mannen, die das Heim unter der Leitung eines Baumeisters (bezahlt von der Regierung) in 1 Jahr aufbauen würden. Diese zweite Alternative beinhaltete die Ausbildung dieser Jugendlichen zu Maurern, die nach Abschluss jeder ein staatliches Baumeisterdiplom erhielt. Gesagt, getan: nach etwa 13 Monaten hatten wir unser Heim für 80 Studenten und 25 Maurer hatten eine solide Ausbildung. Noch Jahre später traf ich den einen oder anderen dieser Baumeister: es fehlte ihnen nie an Bauaufträgen und deren Familien ging es gut.
Nach Arboleda und Florencia kamen, mit den Jahren, noch 3 weitere solcher Heime dazu: San Diego, Samaná und, schlussendlich, Victoria. Gesamthaft 5. Alle im gleichen Departement Caldas)
Die Aufbaumethode war praktisch immer dieselbe: mit Finanzmitteln aus der Schweiz kauften wir jeweils das Land, die Gemeindebehörden halfen mit und die späteren Nutzniesser – die Bauern und ihre Kinder – halfen mit der Arbeit und mit Lebensmitteln, damit das Mittagessen bei den Aufbauarbeiten im zukünftigen Heim nie fehlte.
Jedes Landjugendheim wurde dann den Bauern, die sich immer in einer Basisorganisation zusammenschlossen, übergeben. Trotzdem blieben wir immer in engem Kontakt zu ihnen.
Vor rund einem Jahr zogen wir eine erste Bilanz: in diesen 28 Jahren, seit dem Aufbau des ersten Heimes,
konnten rund 8000 Bauernkinder ihr Mittelschulstudium abschliessen.
Nicht alle, aber viele, dieser Maturanten, gingen dann anschliessend an die Universitäten der Departements-Hauptstadt Manizales. So gibt es unter ihnen Pfarrer, kath. Schwestern, Ärzte, Krankenschwestern, Agronomen, Lehrer-Innen etc. Viele von ihnen arbeiten heute in den gleichen Dörfern dieser Landjugendheime und helfen bei der Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bauerngemeinschaften.

Aber einen Studenten des Heimes von Florencia möchte ich ganz besonders erwähnen. Edilberto García. Er kam 1993 als Student ins Heim und studierte dort bis zum Maturaabschluss, 4 Jahre später. Bei jedem meiner Besuche in Florencia kam ich gegen Feierabend immer ins Heim um mit den Studenten zu plaudern. Dabei fiel mir besonders Edilberto auf: intelligent, fröhlich, an allen Themen interessiert und gesprächsfreudig. So war es für mich gleich klar, dass dieser Student gefördert werden musste, besonders auch darum, weil gleich darauf sein Vater von der Guerrilla ermordet wurde. Mit unserer Hilfe engagierte er sich in 2 Landjugendheimen und studierte an der Uni weiter: zuerst Unernehmungsberatung und Buchhaltung (beide mit Abschlusstitel) und dann noch einen Master in Sozialarbeit. Nach diesem letzten Abschluss koordinierte er unsere Entwicklungsprogramme in diesem Teil des Departementes. Sein äusserst guter sozialer Einsatz und seine kompetente Führung der Mitarbeiter überzeugten uns im Vorstand der Stiftung Apoyar dermassen, dass wir ihn vor 2 Jahren zum neuen Direktor ernannten. Und wir haben uns nicht getäuscht, er führt seither die Stiftung mit Überzeugung und hat bereits die Mitfinanzierung staatlicher Stellen für unsere Projekte erreicht. Für mich ist er eine Art “Adoptivsohn” der die nun 30-jährige Arbeit kompetent weiterführen wird.